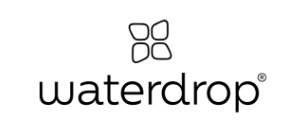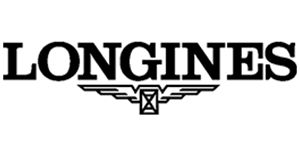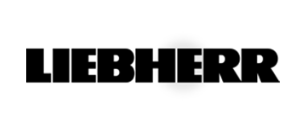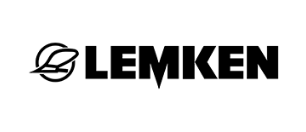Das erwartet euch
Im Performance Marketing geht es immer wieder um dieselbe Frage:
Hat die Kampagne wirklich etwas gebracht oder wäre die Conversion auch ohne sie passiert?
Gerade bei Meta Ads ist diese Frage nicht leicht zu beantworten. Klassische Kennzahlen wie ROAS oder CTR geben Hinweise auf Effizienz, beantworten aber nicht, ob eine Maßnahme tatsächlich inkrementelle Wirkung erzeugt hat. Genau hier setzt das Thema Incrementality an.
In diesem Beitrag erklären wir, was Incrementality bedeutet, warum es auf Meta-Plattformen zunehmend an Bedeutung gewinnt und wie ihr Inkrementalität in eurer Kampagnenbewertung korrekt messen könnt.
Was wir unter Incrementality verstehen
Incrementality oder auf Deutsch: Inkrementalität misst, welchen tatsächlichen Einfluss eine Kampagne auf das Nutzerverhalten hat – unabhängig von klassischen KPIs wie ROAS oder CTR.
Anders gesagt: Hat die Ad wirklich neue Käufe ausgelöst oder hätte der/die KundIn auch so gekauft? Klingt erstmal theoretisch – ist aber gerade im Retargeting und bei Marken-Kampagnen oft entscheidend. Denn Performance heißt nicht nur Zahlen optimieren, sondern verstehen, was wirklich wirkt. Incrementality hilft dabei, Wirkung von reiner Präsenz zu trennen – also zu erkennen, welche Kampagnen tatsächlich zur Kaufentscheidung beigetragen haben. Nur so lassen sich Budgets langfristig sinnvoll und wirkungsorientiert steuern.
Warum ist Incrementality auf Meta besonders relevant?
Meta entwickelt sich zunehmend zu einer Blackbox. Neue Formate wie Advantage+, Broad Targeting oder Performance Max setzen auf Automatisierung. Kampagnen werden auf Basis algorithmischer Modelle ausgespielt, oft ohne klares Targeting oder manuelle Steuerung.
Was das bedeutet?
- Ihr gebt Budget und Ziel vor, Meta übernimmt den Rest.
- Die Plattform trifft Entscheidungen, die ihr nicht im Detail nachvollziehen könnt.
- Klassische Auswertungen wie ROAS liefern ein verzerrtes Bild, wenn sie nicht inkrementelle Effekte berücksichtigen.
In diesem Kontext wird es entscheidend, den kausalen Beitrag eurer Kampagnen zu messen, statt euch ausschließlich auf Plattformdaten zu verlassen. Nur so könnt ihr beurteilen, ob euer Budget sinnvoll eingesetzt ist.
Incrementality vs. Attribution: Der Unterschied
Die meisten Performance-Setups arbeiten mit Attributionsmodellen. Diese weisen Conversions der jeweils letzten Interaktion oder einem Touchpoint im Funnel zu. In der Praxis heißt das oft:
- Eine Anzeige wird als erfolgreich bewertet, wenn sie irgendeinen Beitrag zum Kauf hatte.
- Es wird nicht hinterfragt, ob der Kauf auch ohne die Anzeige passiert wäre.
Incrementality geht einen Schritt weiter. Es misst, ob eine Anzeige eine Handlung verursacht hat – nicht nur, ob sie daran beteiligt war. Dieses kausale Verständnis ist essenziell, um Wirkung von reiner Präsenz zu unterscheiden.
Wie funktioniert ein Incrementality-Test
Ein Incrementality-Test basiert auf einem einfachen Grundprinzip: dem Vergleich zweier Gruppen unter gleichen Bedingungen, mit einer entscheidenden Ausnahme: Nur eine Gruppe wird mit eurer Kampagne bespielt. Diese Gruppen heißen Testgruppe und Kontrollgruppe.
Die Testgruppe ist die Zielgruppe, die eure Anzeigen zu sehen bekommt, genau wie bei einer normalen Kampagne. Ihr steuert hier wie gewohnt eure Creatives, Budgets, Platzierungen und Laufzeiten. Die Kontrollgruppe ist identisch zur Testgruppe, bekommt aber bewusst keine Werbeanzeigen ausgespielt.
Am Ende des definierten Testzeitraums vergleicht ihr die Performance der beiden Gruppen, typischerweise anhand von Conversions wie Käufen, Leads oder App-Installs. Der daraus resultierende Unterschied ist der sogenannte Incremental Lift, also der Anteil an Conversions, der direkt auf die Kampagne zurückzuführen ist.

Beispiel:
Angenommen, jede Gruppe umfasst 100.000 NutzerInnen. Während des Testzeitraums erzielen 4.500 Personen aus der Testgruppe einen Kauf, in der Kontrollgruppe sind es 3.800.
Das bedeutet, in der Testgruppe wurden 700 zusätzliche Conversions generiert, diese stellen den Incremental Lift dar und sind höchstwahrscheinlich auf den Kontakt mit eurer Kampagne zurückzuführen, da sie in der vergleichbaren Kontrollgruppe nicht stattgefunden haben. In relativen Zahlen ergibt das einen inkrementellen Effekt von etwa 18 % (700 von 3.800).
Mit genau dieser Messung beantwortet ihr die zentrale Frage: Wie viele Conversions hätte es ohne diese Kampagne gegeben und was wurde wirklich zusätzlich erreicht?
Wichtig ist dabei: Nur wenn eure Test- und Kontrollgruppe sauber voneinander getrennt sind und gleichwertige Voraussetzungen haben, ist das Ergebnis belastbar.

Methoden zur Durchführung von Incrementality-Tests
Je nach Zielsetzung, Setup und Plattform eignen sich verschiedene Methoden für die Durchführung:
Geo-Lift-Test
Hier wird die Zielregion geografisch unterteilt. Eine Region erhält Werbeanzeigen (Test), eine andere nicht (Kontrollgruppe). Nach Kampagnenende werden die Verkaufszahlen in beiden Regionen verglichen.
- Vorteil: unkompliziert, kein User-Tracking nötig
- Nachteil: äußere Einflüsse wie Wetter, lokale Aktionen etc. können Ergebnisse verfälschen
Holdout-Gruppen
Eine definierte Zielgruppe wird bewusst von der Anzeigen-Ausspielung ausgeschlossen. Das ist auf Meta über Custom Audiences steuerbar.
- Vorteil: kontrollierbare Zielgruppen, präzise Auswertung
- Nachteil: technischer Aufwand, braucht saubere Audiences
Plattformbasierte Lift-Tests (z. B. Meta Conversion Lift)
Meta selbst bietet ein Conversion-Lift-Tool an. Hier erstellt Meta automatisch eine Kontrollgruppe, die keine Anzeigen sieht, und vergleicht die Ergebnisse statistisch.
- Vorteil: einfache Implementierung, zuverlässige Daten
- Nachteil: Mindestbudget erforderlich, Ergebnisse nur innerhalb des Meta-Kosmos nutzbar
Wann ist ein Incrementality-Test sinnvoll?
Incrementality-Tests eignen sich besonders in folgenden Szenarien:
- Retargeting-Kampagnen: Hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass NutzerInnen ohnehin gekauft hätten. Ohne Test ist der inkrementelle Mehrwert kaum messbar.
- Brand-Kampagnen: Häufig erzielen diese weniger direkte Conversions, haben aber nachhaltige Wirkung auf Markenwahrnehmung und Kaufverhalten.
- Neue Funnel-Strategien: Wenn ihr neue Zielgruppen oder Touchpoints testet, könnt ihr mit einem Inkrementalitäts-Test den echten Einfluss bewerten.
- Budgetentscheidungen: Vor Skalierung oder Neuzuweisung von Budgets helfen die Ergebnisse, valide Entscheidungen zu treffen.
Typische Stolpersteine & Best Practices
Herausforderungen
- Externe Faktoren: Saisonale Effekte, Produktverfügbarkeiten oder Preisaktionen können die Vergleichbarkeit beeinflussen.
- Audience-Überschneidungen: Test- und Kontrollgruppen dürfen sich nicht überschneiden – sonst werden die Ergebnisse unbrauchbar.
- Signifikanz: Zu kleine Testgruppen oder zu kurze Laufzeiten führen zu nicht belastbaren Ergebnissen.
Empfehlungen
- Klares Ziel definieren: Was genau wollt ihr herausfinden? Z. B. „Steigert unser Retargeting die Zahl der Neukäufe?“
- Ausreichend Datenbasis schaffen: Plant genügend Laufzeit und Reichweite ein.
- Auf externe Tools setzen: Bei größeren Kampagnen oder komplexen Setups helfen spezialisierte Lösungen wie AppsFlyer oder Measured dabei, Tests effizient aufzusetzen und auszuwerten.
- Regelmäßig testen: Incrementality ist kein Einmal-Test, sondern ein kontinuierliches Messinstrument.
Fazit: Mehr Wirkung durch saubere Bewertung
Incrementality schafft dort Klarheit, wo klassische Performance-Kennzahlen an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere auf Meta – mit zunehmender Automatisierung und weniger Einblick in das genaue Kampagnenverhalten – wird die kausale Bewertung eurer Maßnahmen unverzichtbar.
Wer heute erfolgreich skalieren will, muss wissen, welche Kampagnen echten Mehrwert liefern – und welche nur gut aussehen, ohne echten Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten.
Performance Marketing Agentur & Social Recruiting
Als Performance Marketing Agentur wissen wir: Auch im Social Recruiting entscheidet am Ende nicht nur der CPM, sondern ob eine Kampagne wirklich wirkt. Incrementality-Tests helfen uns genau dabei: herauszufinden, ob eure Recruiting-Kampagnen nicht nur Klicks bringen, sondern tatsächlich neue BewerberInnen aktivieren.
Auf dieser Basis entwickeln wir Social-Recruiting-Kampagnen, die nicht nur gut aussehen, sondern gezielt funktionieren. Wir gestalten aufmerksamkeitsstarke Creatives für Meta, LinkedIn, TikTok & Co. – und sorgen dafür, dass eure Jobanzeigen dort ausgespielt werden, wo sie Wirkung zeigen.
Ihr wollt wissen, ob eure Recruiting-Kampagnen wirklich performen oder ob ihr Potenzial verschenkt? Dann sichert euch unser kostenloses Audit. Wir analysieren Seiten, Creatives und Conversions – und sagen euch ehrlich, ob und wie sich euer Setup verbessern lässt.
Meldet euch gerne, wir freuen uns auf euch!